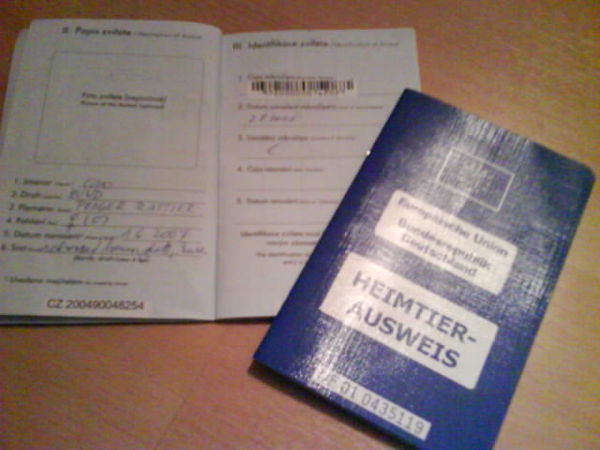|
Gesundheit
Impfungen
Eine regelmäßige Impfung ist in jedem Fall unerlässlich!
Impfschema
| Alter in Wochen |
5 |
9 |
12 |
16* |
jährliche Wiederholung** |
| Welpen-/Parvoimpfung |
x |
|
|
|
|
| 7fach-Impfung |
|
x |
x |
x |
x |
| Tollwutimpfung |
|
|
x |
x |
|
| 8fach-Impfung* |
|
|
|
|
x |
* Empfehlung nach Prof. Truyen, Universität Leipzig
** Je nach empfohlenem Impfintervall für Tollwut erfolgt die Impfung mit oder ohne Tollwut
Gegen was wird geimpft?
Staupe
Die Staupe ist eine der bekanntesten und gefürchtetsten Infektionskrankheiten der Hunde. Das Staupevirus kommt in allen Ländern mit Hundehaltung vor und ist auch hierzulande noch weit verbreitet. Ihr Hund kann sich nicht nur durch Kontakt mit einem anderen Hund anstecken. Gefahr droht vielmehr auch beim Waldspaziergang, weil z. B. Marder und Frettchen die Krankheit übertragen können.
Die Viren werden von infizierten Tieren mit allen Körperflüssigkeiten ausgeschieden. Eine besondere Gefahr sind Tiere, die Erreger ausscheiden, ohne selbst Krankheitsanzeichen zu zeigen. Besonders Hundewelpen sind in den ersten Lebenswochen gefährdet, aber auch ältere Hunde können erkranken.
Erste Krankheitsanzeichen treten etwa 1 Woche nach der Ansteckung auf. Sie beginnen mit hohem Fieber, Appetitlosigkeit und Mattigkeit. Begleitet werden die Symptome von anfänglich wässrig-klarem Augen- und Nasenausfluss, der im weiteren Verlauf dann zähflüssig-eitrig wird. Dieser Ausfluss ist in höchstem Maße ansteckend. Entweder unmittelbar anschließend, oder nach einer Phase der scheinbaren Erholung, können weitere Krankheitssymptome auftreten: Erbrechen, wässriger bis blutiger Durchfall (Darmform der Staupe) und/oder Husten, Atembeschwerden, Lungenentzündung (Lungenform der Staupe).
Eine besonders gefürchtete Komplikation ist die sog. nervöse Form der Staupe. Dabei verursacht das Staupevirus Schädigungen im Gehirn. Dies äußert sich in psychischen Veränderungen, Zittern, Gleichgewichtsstörungen, Lähmungen und Krampfanfällen, vergleichbar dem Erscheinungsbild der Epilepsie. Der Schweregrad der verschiedenen Formen kann variieren. Die "nervöse" Form endet jedoch praktisch immer tödlich bzw. erfordert, dass der Hund aus tierschützerischen Gründen eingeschläfert werden muss.
Der Verlauf der Erkrankung kann sehr unterschiedlich sein und zu bleibenden Schäden führen, wie z. B. an den Zähnen (Staupegebiss) oder den Fußballen (Hard-Pad-Disease); häufig endet sie jedoch tödlich.
Hepatitis (H.c.c.)
Auch bei Hunden gibt es eine ansteckende Virushepatitis. Gefährdet sind allerdings nur Hunde. Auf den Menschen ist diese Infektionskrankheit nicht übertragbar. Kranke, aber auch gesund erscheinende Hunde sind die Hauptüberträger der Erkrankung. Ein direkter Kontakt zwischen Hunden ist jedoch nicht immer erforderlich, weil das Virus lange ansteckend bleibt und so auch indirekt übertragen werden kann. Hunde, welche die Erkrankung überstanden haben, können noch monatelang Hepatitisviren ausscheiden und verbreiten.
Die Krankheit beginnt, wie alle Virusinfektionen, mit Fieber, allgemeiner Mattigkeit, Appetitlosigkeit. Im weiteren Verlauf kommt es zu Augen- und Nasenausfluss (aus diesem Grund wurde die Krankheit früher oft mit Staupe verwechselt), Erbrechen, manchmal auch Durchfall und zu Schmerzen im Bauchbereich.
Als Leitsymptom kann eine Berührungsempfindlichkeit in der Leberregion angesehen werden.
Die Leberschädigung verursacht unter anderem Störungen in der Blutgerinnung. Daneben kann es bei dieser Erkrankung auch zu einer vorübergehenden Hornhauttrübung am Auge und zu chronischen Nierenschäden kommen. Schwerst erkrankte Hunde sterben unter Krämpfen teilweise sogar über Nacht, ohne vorher lange krank gewesen zu sein. Hunde, die überleben, zeigen verringerte Gewichtszunahme, und oftmals bleibt eine chronische Hepatitis zurück.
Bei Welpen kann es innerhalb von 2-5 Tagen nach der Ansteckung zu plötzlichen Todesfällen kommen.
Parvovirose
Praktisch über Nacht verbreitete zu Beginn der 1980er Jahre eine für Hunde tödliche Virusinfektion Angst und Schrecken bei Hundebesitzern: Parvovirose. Parvoviren, die Erreger dieser Krankheit, werden von betroffenen Hunden millionenfach über einen längeren Zeitraum mit dem Kot ausgeschieden. Virushaltiger Kot ist also die Hauptursache für eine Ansteckung. Besonders gravierend ist dabei das Problem, dass die Erreger sehr langlebig sind und eine hohe Ansteckungsfähigkeit haben. Noch Jahre später können sie eine Erkrankung hervorrufen, sie besitzen eine hohe Widerstandskraft gegenüber Umwelteinflüssen wie z. B. Hitze und Kälte, aber auch gegen Desinfektionsmittel.
Praktisch jedes "Hundehäufchen" stellt eine potenzielle Gefahr dar. Sei es, dass Ihr Hund beim Ausgang daran schnuppert, oder dass Sie selbst das Virus, z. B. an den Schuhen haftend, mit nach Hause bringen. Von der Ansteckung bis zum Krankheitsausbruch (Inkubationszeit) vergehen nur 3-7 Tage.
Die Erkrankung beginnt zunächst mit Fieber und Mattigkeit. Bald darauf stellt sich Erbrechen und schwerer, meist blutiger Durchfall ein. Bei sehr jungenWelpen kann die Infektion zum akuten Herztod führen, ohne dass die Welpen vorher Krankheitssymptome gezeigt haben. Erkrankte Hunde müssen umgehend in tierärztliche Intensivbehandlung.
Da gegen das Virus alle Medikamente nahezu unwirksam sind, kommt es trotz intensiver Behandlung vor allem bei jüngeren Hunden häufig zum tödlichen Verlauf.
Bei Hunden, die die Erkrankung überleben, können dauerhafte Herzschäden mit entsprechend eingeschränkter Leistungsfähigkeit zurückbleiben. Die Parvovirose wird gelegentlich auch als "Katzenseuche der Hunde" bezeichnet. Eine Ansteckung durch Katzen ist jedoch ausgeschlossen. Dagegen können Hunde in seltenen Fällen als Ansteckungsquelle für Katzen fungieren.
Untersuchungsergebnisse von Prof. Truyen (Universität Leipzig) haben gezeigt, dass die zweimalige Impfung gegen Parvovirose in vielen Fällen nicht ausreicht, um Hunde sicher vor Parvovirose zu schützen. Ausgehend von den Ergebnissen der Studie rät Prof. Truyen daher zu einer frühen Parvoimpfung ab der 6. Woche und zu einer Nachimpfung in der
15.-16. Lebenswoche.
Leptospirose
(Stuttgarter Hundeseuche, Weilsche Krankheit)
Diese Infektionskrankheiten werden durch bestimmte Bakterien hervorgerufen und können sowohl Tiere als auch Menschen betreffen.
Die Erkrankung zählt somit zu den möglichen Zoonosen.
Hunde jeder Altersgruppe sind für die Krankheiten empfänglich. Infizierte Hunde können Erreger über lange Zeit mit dem Urin ausscheiden. Daneben sind infizierte Ratten und Mäuse eine wichtige Infektionsquelle. Jedoch muss der Hund nicht unbedingt direkten Kontakt mit diesen Tieren oder mit Artgenossen haben. Der Erreger kann nämlich über längere Zeit in Pfützen überleben, sodass sich Hunde, die daraus trinken, auch auf diesem Weg anstecken können.
Ein bis zwei Wochen nach der Infektion kommt es zur Erkrankung mit oft typischen, schwer zu deutenden Symptomen. In schweren Fällen beginnt die Krankheit mit plötzlicher Schwäche, Futterverweigerung, Erbrechen und Fieber. Atembeschwerden und vermehrter Durst sind ebenso wie häufiger Harnabsatz weitere Anzeichen. Bei manchen Hunden entwickelt sich eine Gelbsucht. Erkrankte Hunde erheben sich nur ungern und äußern Schmerzen bei Druck auf die Nierengegend. Das Überstehen der Krankheit kann chronische Nierenschäden hinterlassen.
Coronavirusinfektion
Hierbei handelt es sich um eine erst seit kurzem bekannte, hoch ansteckende Darminfektion. Die Krankheit kann Hunde jeden Alters befallen. Die Infektion ist in Europa, Nordamerika und Australien bekannt, dürfte jedoch weltweit verbreitet sein. Das Virus verursacht besonders bei jungen Hunden Fressunlust, wässrigen Durchfall mit Blutbeimengung und Erbrechen. Die Krankheit ist deshalb nur schwer von der Parvovirose zu unterscheiden, die jedoch in der Regel weitaus schwerer verläuft. Die Ansteckung mit dem Coronavirus erfolgt durch Kontakt mit Kot, der von infizierten Hunden ausgeschieden wird.
Virushusten
Diese Erkrankung der Luftröhre und der Bronchien wird oft irreführend auch als Zwingerhusten bezeichnet. Der Grund dafür ist, dass zwar am häufigsten Hunde betroffen sind, die mit vielen anderen eng zusammenleben (z. B. im Zwinger, Tierheim, Hundesportplatz), grundsätzlich kann aber jeder Hund davon betroffen sein, der beim Auslauf mit Artgenossen in Kontakt kommt. Die Ansteckung erfolgt durch eine Tröpfcheninfektion. Die Ursache für den Husten sind bestimmte Virusarten, wie z. B. das Parainfluenza- und das Adenovirus. Bakterien können zu einem komplizierten Krankheitsverlauf mit Lungenentzündung beitragen, wenngleich in den seltensten Fällen akute Lebensgefahr besteht. Gequälter, trockener Husten, der anfallsweise heftig bellend auftritt, beeinträchtigt aber das Allgemeinbefinden und die Leistungsfähigkeit der Hunde außerordentlich. Überall wo viele Hunde zusammenkommen, verbreitet sich der Husten sehr rasch.
Vorbeugung:
Spezielle, moderne Kombinationsimpfstoffe, die üblicherweise zur Schutzimpfung gegen die in dieser Broschüre beschriebenen Krankheiten eingesetzt werden, schützen auch gegen Parainfluenza- und Adenoviren, die am Zustandekommen des Virushusten beteiligt sind. Faktoren, die eine Schwächung der körpereigenen Abwehr verursachen, können die Erkrankung begünstigen. Zur Unterstützung der Abwehrkräfte sollten die Tiere vor negativen Stressfaktoren eine Stärkung der angeborenen Immunabwehr durch einen Immunmodulator bekommen.
Tollwut
Gewiss sind Ihnen die veterinärpolizeilichen Hinweisschilder auf einen "Tollwutsperrbezirk" an vielen Ortseinfahrten bekannt. Der Gesetzgeber trägt damit der Tatsache Rechnung, dass die Tollwut nach wie vor eine der gefährlichsten Virusinfektionen für Mensch und Tier ist. Tollwut ist nicht heilbar. Empfänglich für die Krankheit sind alle warmblütigen Tiere. Die Hauptinfektionsquelle sind wild lebende Fleischfresser, in erster Linie Füchse. In letzter Zeit wurde das Virus aber auch verschiedentlich bei Fledermäusen nachgewiesen. Tollwutviren werden von infizierten Tieren mit dem Speichel ausgeschieden. Bissverletzungen durch tollwutinfizierte Tiere sind deshalb besonders gefährlich, weil das Virus über Wunden in den Körper gelangt, aber auch Hautverletzungen wie Schürfwunden sind mögliche Eintrittspforten. Deshalb sollten Sie auch unbedingt vermeiden, "besonders zutrauliche Wildtiere" oder zum Beispiel einen überfahrenen Fuchs mit der bloßen Hand zu berühren.
Das Auftreten der Erkrankungserscheinungen nach der Infektion kann sich über 14-30 Tage, selten auch länger hinziehen. Der Erreger wandert von der Eintrittspforte entlang der Nervenbahnen über das Rückenmark zum Gehirn. Von dort gelangen die Erreger in die Speicheldrüsen. Die Übertragung der Tollwuterreger ist bereits vor deutlichen Krankheitsanzeichen möglich.
In typischen Fällen verläuft die Tollwut in drei Phasen. Das erste Anzeichen ist oft eine Verhaltensänderung (scheue Tiere werden z. B. zutraulich).
Im weiteren Verlauf kann es zu Erregungszuständen und Aggressivität (Exzitationsstadium) und schließlich kurz vor dem Tod zu Lähmungen (Paralysestadium) kommen. Häufig können die Tiere aufgrund der Lähmung nicht mehr schlucken, die Tiere speicheln und können nicht trinken. Da die Krankheitserscheinungen bei Tollwut sehr vielfältig sein können, muss dringend empfohlen werden, falls Sie selbst oder Ihr Hund Kontakt mit einem tollwutkranken oder verdächtigen Tier hatten, unverzüglich einen Arzt oder Tierarzt aufzusuchen. Geimpfte Hunde sind in diesem Fall rechtlich besser gestellt als ungeimpfte, für die eine sofortige Tötung angeordnet werden kann.
Für Auslandsreisen ist zu beachten, dass die einzelnen Länder so genannte Einreisebestimmungen erlassen haben. In der Mehrzahl der Fälle wird die Einreise mit einem Hund nur dann erlaubt, wenn eine gültige Tollwutimpfung nachgewiesen werden kann. Diese muss laut geltender Tollwutverordnung mindestens 21 Tage und längstens um den Zeitraum zurückliegen, den der Impfstoffhersteller für eine Wiederholungsimpfung angibt. Nähere Auskünfte erteilen Tierärzte, das Deutsche Grüne Kreuz, Veterinärämter und Automobilclubs.
Wenn der Hund mit ins Ausland genommen werden soll, müssen die landeseigenen Vorschriften beachtet werden. Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig über die aktuellen Anforderungen.
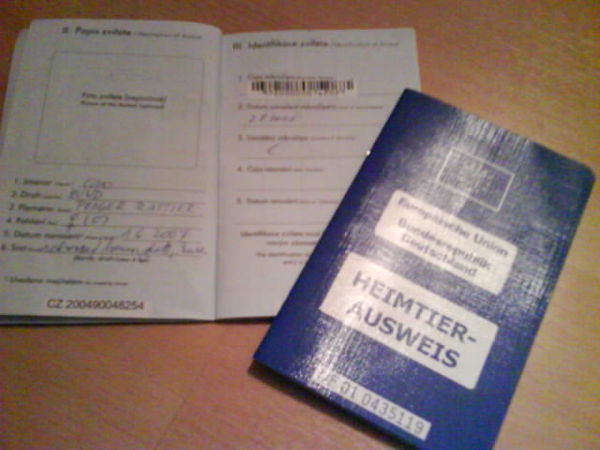  
Entwurmung
Auch auf eine regelmäßige Entwurmung können Sie nicht verzichten!
Die Würmer unserer Hunde und Katzen sind Parasiten. Sie leben also als Schmarotzer im Darm oder Magen der Wirtstiere und können dieses durch Verletzungen und Stoffwechselgifte erheblich schädigen. Es gibt zwei Hauptarten von Würmern, die unsere Hunde und Katzen befallen können: Rundwürmer und Bandwürmer.
Allgemeine Gefahren:
Die gesundheitlichen Schäden, die Würmer bei Hunden und Katzen anrichten können, sind sehr unterschiedlich. Sie reichen von der allgemeinen Schwächung des Tieres und dessen Abwehrsystems bis hin zum Tod des Tieres im schlimmsten Fall.
Neben der Gefährdung des Tieres besteht auch für den Menschen Infektionsgefahr. Die Infektion mit Würmern kann zu schweren Organstörungen und -schäden führen, die sogar tödlich verlaufen können.
Um diese Schäden für Tier und Mensch wirkungsvoll verhindern zu können, sollten Hunde und Katzen regelmäßig (alle drei Monate) entwurmt werden
Infektion:
Ihr Tier kann sich auf verschiedenste Weise mit Würmern infizieren. Nach der Ansteckung gelangen die Eier oder Larven in den Darm der Tiere und entwickeln sich im Körper zum ausgewachsenen Wurm. Dabei wandern sie meist durch verschiedene Organe und können erhebliche Verletzungen verursachen.
Leider ist es kaum möglich, einer Infektion vorzubeugen, da man die Tiere den Gefahrenquellen nicht entziehen kann. Hunde und Katzen mit Auslauf können sich quasi überall infizieren. Selbst nur in der Wohnung gehaltene Tiere können sich mit an den Schuhen haftenden Eiern oder über Zwischenwirte (z.B. Flöhe) anstecken. Daher ist die regelmäßige Entwurmung der Tiere mit geeigneten Mitteln zu empfehlen.
Nach den Infektionswegen unterscheidet grundsätzlich man folgende Infektionsmöglichkeiten:
Ansteckung durch Mund oder Nahrung (orale Infektion)
Durch Auflecken von Wurmeiern oder -larven (Spul- und Hakenwürmer) aus der Umgebung oder durch Fressen infizierter Zwischenwirte wie Mäuse oder Vögel (Bandwürmer) oder Flöhe (Bandwürmer) können sich die Tiere mit Würmern infizieren.
Ansteckung durch die Haut (perkutane Infektion)
Hakenwurmlarven können auch durch die Haut in das Tier eindringen.
Ansteckung über die Mutter (intrauterine und laktogene Infektion)
Ruhende Larven (Dauerlarven) im Körpergewebe des Muttertieres werden erenut mobilisiert und erreichen über das Blut in die Gebärmutter und die Milchdrüsen. Sie infizieren die ungeborenen Welpen. Nach der Geburt nehmen die Jungtiere weitere Wurmlarven über die Milch auf (Spulwürmer).
Sympthome:
Ihr Tier kann von Würmern befallen sein, ohne dass Sie dies merken. Fast alle Hunde und Katzen durchlaufen in ihrem Leben eine Infektion mit Würmern. Die Symptome hängen stark von Alter, Gesundheitszustand und Widerstandsfähigkeit des Tieres und von der jeweiligen Wurmart ab. Da die Symptome aber meist keinen direkten Rückschluss auf die Art der Wurminfektion zulassen, empfiehlt sich die Behandlung mit einem Mittel, dass gegen alle Wurmarten wirkt.
Folgende Symptome können auf Wurmbefall hinweisen:
- sichtbare Wurmteile im Kot (Untersuchung durch Tierarzt)
- Erbrechen
- Blutarmut
- Blut im Kot
- schlechte Wundheilung
- glanzloses, struppiges Fell
- Gewichtsverlust, Abmagerung
- aufgeblähter Bauch bei Jungtieren (sog. Wurmbauch)
- verminderte Fruchtbarkeit
- Leistungsminderung
- allgemein herabgesetzte Widerstandskraft und Vitalität
Bei Jungtieren kann massiver Befall der Tiere sogar zum Tod führen!
Diagose:
Die Diagnose des Wurmbefalls geschieht meist über die mirkoskopische Untersuchung des Tierkotes. Sie ist aufwendig und leider nicht ganz zuverlässig.
Dies liegt zum einen an der unregelmäßigen Eiausscheidung und den unterschiedlichen Entwicklungsstadien der verschiedenen Wurmarten. Das negative Ergebnis einer Kotuntersuchung besagt also nur, dass zur Untersuchung keine Wurmeier oder -larven im Tierkot nachgewiesen werden können, aber nicht dass das Tier keine Würmer hat.
Zum anderen können die auch für den Menschen sehr gefährlichen Arten kaum von den harmloseren Wurmarten unterschieden werden. Außerdem kann es bei der Feststellung der Verwurmung schon zu erheblichen gesundheitlichen Schäden beim Tier gekommen sein.
Beim Auftauchen von Symptomen sollte daher immer eine sofortige Entwurmung durchgeführt werden, um die Gesundheitsschäden für das Tier zu begrenzen. Darüber hinaus empfehlen Fachleute die regelmäßige Entwurmung des Tieres viermal im Jahr. Nur so können Sie Ihr Tier und auch Ihre Familie dauerhaft vor der Wurmgefahr schützen. Fragen Sie Ihren Tierarzt!
Behandlung:
Jeder Wurmbefall bei Ihrem Hund oder Ihrer Katze sollte möglichst rasch behandelt werden. Zum einen, um die drohenden Gesundheitsgefahren für das Tier abzuwenden, zum anderen, um Sie und Ihre Familie vor einer möglichen Ansteckung mit Wurmeiern zu schützen.
Neben der akuten Behandlung empfiehlt sich außerdem die routinemäßige, in regelmäßigen Abständen vorgenommene Entwurmung Ihres Haustieres (optimal: 4 mal im Jahr) mit einem Breitspektrum-Entwurmungsmittel (gegen Band- und Rundwürmer). Damit schützen Sie Ihr Haustier optimal vor den Gefahren der Wurminfektion und reduzieren die Verseuchung der Umwelt mit infektiösen Wurmeiern.
Nur durch regelmäßige Entwurmung Ihrer Haustiere können Sie sich und Ihre Familie (besonders Ihre Kinder) umfassend und zuverlässig vor möglichen Ansteckungen schützen. Der Kontakt zu Ihrem Haustier kann dann ohne Gefahr so eng bleiben, wie er ist.
Erklärung der unterschiedlichen Wurmarten
Bandwürmer
Bei ausreichender Ernährung der Hunde wird eine geringe Anzahl von Bandwürmern von ihren Wirten toleriert, ohne dass es zu Krankheitssymptomen kommt. Erst der massive Befall führt zu Mangelversorgung und Verdauungsproblemen.
Vorkommen
Bandwürmer wie der Gurkenkernbandwurm oder die zahlreichen Mitglieder der Taenia-Familie kommen weltweit vor. Dagegen ist der Kleine Fuchsbandwurm auf Mitteleuropa beschränkt.
Symptome
Massiver Bandwurmbefall verursacht Verdauungsbeschwerden und Mangelversorgung der Hunde, die sich in vermindertem Leistungsvermögen, Lethargie, Anfälligkeit für Krankheiten, aber auch durch glanzloses, struppiges Fell äußern kann. Verstopfungen und Darmverschluss können auftreten. Wenn die mobilen Bandwurmsegmente den Darm verlassen, kann es im Analbereich zu einem starken Juckreiz kommen.
Behandlung und Vorbeugung
Bandwürmer lassen sich durch moderne Wurmmittel einfach und effektiv entfernen. Werden diese Mittel im Rahmen einer regelmäßigen Entwurmung alle drei Monate verabreicht, können auch keine neu verschluckten Wurmeier oder -larven zu ausgewachsenen Würmern heranwachsen.
Gefahren für den Menschen
Infektion mit dem Kleinen Fuchsbandwurm kann zur lebensgefährlichen alveolären Echinokokkose führen, während Taenia-Bandwurminfektionen weniger schwerwiegende Symptome aufweisen.
Hakenwürmer
Hakenwürmer beißen sich in der Darmschleimhaut ihrer Wirte fest und ernähren sich vom Blut der Hunde. Der Blutverlust kann beträchtlich sein, denn ein einziges Hakenwurmweibchen kann pro Tag bis zu 0,5 Milliliter Blut aufnehmen. Charakteristisch für Hakenwürmer ist der Infektionsweg über die Haut des Wirtes. Aber auch das Verschlucken einer Larve kann zur Besiedelung des Hundedarms führen.
Vorkommen
Hakenwürmer kommen in Mittel- und Südeuropa vor. Eine Studie bei Tierärzten in Deutschland fand bei 8,6 Prozent aller untersuchten Hunde Hakenwürmer.
Symptome
Geringe Befallsraten an Hakenwürmern werden ohne Krankheitsanzeichen des Hundes toleriert, erst bei massivem Befall kann es zu schweren Schädigungen kommen. Dazu zählt vor allem der Blutverlust, der zum Tod des Tieres führen kann. Der Hakenwurmbefall wird durch Blut im Kot oder durch eine Dunkelfärbung der Exkremente deutlich. Daneben können Hakenwurmlarven, die über die Haut (meist an den Pfoten) in den Hund eindringen, Hautentzündungen und Gewebeschäden verursachen.
Behandlung und Vorbeugung
Hakenwürmer lassen sich durch moderne Wurmmittel einfach und effektiv entfernen. Werden diese Mittel im Rahmen einer regelmäßigen Entwurmung alle drei Monate verabreicht, können neu eingedrungene Wurmlarven rechtzeitig bekämpft werden. Die fachgerechte Entwurmung von Welpen sollte zuvor mit dem Tierarzt besprochen werden.
Gefahren für den Menschen
Hakenwürmer können auch beim Menschen über die Haut (meist die Fußsohlen) in den Körper gelangen.
Peitschenwürmer
Der Peitschenwurm Trichuris vulpis kommt bei Hunden aller Altersklassen vor und hat bei massivem Befall Blutverlust und Verdauungsstörungen zur Folge. Peitschenwürmer benötigen keinen Zwischenwirt und können daher den bereits infizierten Hund bei unzureichender Hygiene erneut befallen.
Vorkommen
Peitschenwürmer sind in unseren Breitengraden nur selten anzutreffen, da ihre Eier wärmere Klimabedingungen benötigen. Sie können den Hund aber im Rahmen einer Urlaubsreise in Südeuropa infizieren.
Symptome
Ein geringer Befall mit Peitschenwürmern bleibt meist symptomlos. Erst bei einer großen Anzahl Würmer treten Blut oder kleine Darmfetzen im Kot auf, der dünnflüssig wird. Blutarmut, Auszehrung und Abgeschlagenheit sind die Folge. Größere Blutverluste sind aber selten.
Behandlung und Vorbeugung
Peitschenwürmer lassen sich durch moderne Wurmmittel einfach und effektiv entfernen. Werden diese Mittel im Rahmen einer regelmäßigen Entwurmung alle drei Monate verabreicht, können neu eingedrungene Wurmlarven rechtzeitig bekämpft werden.
Spulwürmer
Ein Befall durch Spulwürmer wie Toxocara canis beginnt durch das Verschlucken der infektiösen Wurmlarven. Während eine geringe Anzahl von Würmern bei erwachsenen Hunden meist keine Symptome verursacht, kann ein massiver Befall das Tier schädigen. Vor allem Welpen sind durch Wurmbefall gefährdet, und Spulwürmer können bereits den ungeborenen Nachwuchs im Mutterleib infizieren.
Vorkommen
Toxocara canis kommt weltweit vor. Aufgrund der hohen Widerstandsfähigkeit von Eier und Larven müssen heutzutage viele Parks und Spielplätze als wurmverseucht angesehen werden. Ohne regelmäßige Desinfektionen sind öffentliche Hundeklos kaum wurmeierfrei zu halten.
Symptome
Die Schäden, die Spulwürmer bei ihren Wirten verursachen, sind vielfältig und richten sich nach dem Ausmaß des Befalls und dem Larvenstadium des Spulwurms. Die Anwesenheit im Darm kann zur Mangelversorgung des Hundes mit wichtigen Nährstoffen wie Vitaminen und anderen Vitalstoffen führen und in der Folge zu vermindertem Leistungsvermögen, Apathie, Anfälligkeit für Krankheiten aber auch glanzloses, struppiges Fell. Der massive Befall führt zu Verstopfungen im Darmbereich bis hin zum Verschluss der Gallengänge. Durchfall, Erbrechen, Verstopfung, Blut im Kot und Blutarmut des Hundes sind die Folge. Spulwurmlarven, die durch den Körper wandern, können Organe wie etwa Nieren, Leber und Lungen (Symptome: Husten, Rachitis) schädigen oder zu Sehstörungen führen, wenn sie sich in den Augen einnisten.
Besonders Welpen leiden unter einem Spulwurmbefall, gerade wenn die Infektion bereits im Mutterleib erfolgte. Nichtbehandelte Welpen zeigen einen charakteristischen aufgetriebenen Bauch („Wurmbauch“), weisen erhebliche Wachstumsstörungen auf und können oft nicht mehr geheilt werden.
Behandlung und Vorbeugung
Spulwürmer lassen sich durch moderne Wurmmittel einfach und effektiv entfernen. Werden diese Mittel im Rahmen einer regelmäßigen Entwurmung alle drei Monate verabreicht, können neu eingedrungene Wurmlarven rechtzeitig bekämpft werden. Die fachgerechte Entwurmung von Welpen sollte mit dem Tierarzt begesprochen werden.
Gefahr für den Menschen
Spulwürmer der Toxocara-Familie können den Menschen befallen und dort die schwere Toxocariasis verursachen.
Gurkenkernbandwurm
Der Gurkenkernbandwurm (Dipylidum caninum) ist der häufigste Bandwurm des Hundes. Der ausgewachsene Wurm lebt im Verdauungstrakt und ernährt sich vom Nahrungsbrei des Vierbeiners. Dort spaltet er auch seine Bandwurmglieder ab, die den Darm als bewegliche kleine Segmente verlassen und die Wurmeier enthalten. Ein Befall des Hundes verläuft weitgehend symptomlos. Nur bei einem starken Befall des Gurkenkernbandwurmes kommt es zu Verdauungsstörungen.
Überträger
Die Bandwurmlarven siedeln im Darm von Flöhen, wie dem Katzenfloh, sowie in Haarlingen, die allerdings seltener vorkommen. Verschluckt der Hund bei der Fellpflege die infizierten Parasiten, können sich die Wurmlarven im Darm befreien und an der Darmwand festsetzen. Daher gilt die Regel, dass eine effektive Flohbekämpfung gleichzeitig auch meist vor dem Befall mit Gurkenkernbandwürmern schützt. Umgekehrt kann von einem Gurkenkernbandwurmbefall auch auf die Anwesenheit von Flöhen bzw. Haarlingen in der Umgebung des Hundes geschlossen werden.
Vorkommen
Wie seine Flohüberträger kommt der Gurkenkernbandwurm weltweit vor. Da der Flohbefall in der zweiten Jahreshälfte meist stärker ist, wird auch die Gefahr einer Bandwurminfektion in diesem Zeitraum größer sein.
Symptome
Der Befall mit diesen Bandwürmern verläuft bei Hunden meist symptomlos. Erst bei einer großen Wurmzahl oder im Falle von jungen oder geschwächten Tieren kann es zu Verdauungsstörungen einschließlich Durchfall, wechselndem Appetit oder Darmkrämpfen kommen. Die beweglichen, reiskornähnlichen Bandwurmglieder verursachen einen starken Juckreiz am Darmausgang des Hundes, die dieser durch ein Herumrutschen auf rauem Boden zu lindern sucht („Schlittenfahren“ oder „Schlittern“).
Behandlung und Vorbeugung
Bandwürmer wie der Gurkenkernbandwurm lassen sich durch moderne Wurmmittel einfach und effektiv entfernen. Werden diese Mittel im Rahmen einer regelmäßigen Entwurmung alle drei Monate verabreicht, können neu eingedrungene Würmer rechtzeitig bekämpft werden. Eine zweite vorbeugende Maßnahme besteht in der Vermeidung eines Floh- und Haarlingsbefalls, so dass die Wurmlarven erst gar nicht in die Nähe der Hunde gelangen.
Gefahr für den Menschen
Gurkenkernbandwürmer können bei versehentlichem Verschlucken auch im Darm von Menschen heranwachsen. Gerade Kinder sind gefährdet, wenn sie mit einem infizierten Hund spielen und schmusen.
Herzwurm
Erreger
Der Herzwurm (Dirofilaria immitis) aus der Gruppe der Dirofilarien wird als Larve auf ein Wirtstier übertragen und reift dort zum ausgewachsenen Tier heran, das sich in den großen Blutgefäßen der Lunge festsetzt. Im weiteren Verlauf können die Würmer in die Herzgefäße bzw. -vorhöfe einwandern und dort überleben. Da diese Würmer zwischen 20 und 30 Zentimeter groß werden, verursachen sie einen erheblichen Blutstau und damit eine Mangelversorgung.
Überträger
Die Herzwurmlarve wird durch den Stich bestimmter Moskitoarten übertragen. Wie andere Mücken auch, können diese Stechmücken die Wurmlarven nur nach dem Stich eines infizierten Organismus auf ein neues Opfer übertragen.
Vorkommen
Der Herzwurm kommt in Süd- und Osteuropa vor: In den Mittelmeerländern Italien, Spanien, Griechenland oder Frankreich ist der Herzwurm teilweise sehr häufig vertreten (so wurde in der italienischen Po-Ebene eine Befallsrate je nach Region und Untersuchung von bis zu 68 Prozent der Hunde berichtet). Auch auf der Balkanhalbinsel sowie in der Slowakei und in Rumänien ist er anzutreffen. Herzwürmer sind außerdem in den USA sehr weit verbreitet sowie in Kanada, Australien und in Südostasien (inklusive Japan).
Symptome
Ein Befall mit wenigen Würmern wird von Hunden meist symptomlos toleriert; allerdings kann es bei Hunden auch zu einem massiven Befall kommen. Grundsätzlich setzen die Symptome erst Monate nach der eigentlichen Infektion ein. So lange dauert es nämlich, bis sich die Herzwurmlarve zum ausgewachsenen Wurm entwickelt hat. Zunächst kommt es infolge der Mangelversorgung zu Merkmalen allgemeiner Schwäche, Antriebs- und Teilnahmslosigkeit sowie Gewichtsverlust. Charakteristisch sind im weiteren Verlauf oft Atemnot und Husten durch den Wurmbefall der Lunge.
Wandern die Würmer ins Herz, können bei starkem Befall Herzstörungen bis hin zum Herzversagen sowie Leber- und Nierenstörungen und Blutarmut hinzu kommen. Der Urin färbt sich rot. Unerkannt oder zu spät behandelt, führt ein starker Befall meist zum Tod.
Behandlung und Vorbeugung
Herzwürmer können durch Wurmmittel wirkungsvoll bekämpft und abgetötet werden. Allerdings darf mit dem Einsatz nicht gewartet werden, bis sich die ausgewachsenen Würmer in der Lunge festgesetzt haben, denn die absterbenden Würmer verstopfen die Blutgefäße und verursachen so gefährliche Embolien und Thrombosen. Von daher ist eine regelmäßige und rechtzeitige Entwurmung notwendig, um Herzwürmer noch im Larvenstadium nebenwirkungsfrei zu bekämpfen.
Ergänzend ist ein Schutz der Hunde vor dem Angriff der übertragenden Stechmücken als vorbeugende Maßnahme sinnvoll.
Fadenwurm Dirofilaria repens
Erreger
Der Rundwurm Dirofilaria repens gehört zur Familie der Dirofilarien und ist damit ein naher Verwandter des Herzwurms. Ähnlich wie dieser wird auch die Larve von D. repens durch den Stich eines Moskitos übertragen. Allerdings erfolgt die Entwicklung zum ausgewachsenen Wurm in den meisten Fällen subkutan (unter der Haut), so dass die erwachsenen Würmer als Erhebungen sicht- und fühlbar sind.
Überträger
Die Larve von Dirofilaria repens wird durch den Stich bestimmter Moskitoarten übertragen. Wie andere Mücken auch, können diese Stechmücken die Wurmlarven nur nach dem Stich eines infizierten Organismus auf ein neues Opfer übertragen.
Vorkommen
Dirofilaria repens ist in Süd- und Osteuropa heimisch. Hierzu zählen die Mittelmeerländer wie etwa Spanien, Südfrankreich, Italien und Griechenland, aber auch Portugal und die osteuropäischen Länder des Balkans sowie Tschechien, Slowakei, Ungarn und Rumänien.
Außerhalb Europas sind D. repens-Infektionen in Asien (etwa im Mittleren Osten) und Afrika verbreitet.
Symptome
Erkrankungen durch D. repens sind in der Regel für den Hund nicht gefährlich. Nach einer längeren symptomfreien Zeit, währenddessen sich die Wurmlarve in den ausgewachsenen Wurm verwandelt, treten kleine, schmerzlose und verschiebbare Erhebungen auf. Diese können Aussehen und Lage verändern, da sich die Würmer im subkutanen Gewebe bewegen können.
Behandlung und Vorbeugung
Ein Befall mit Dirofilaria repens kann durch Wurmmittel wirkungsvoll bekämpft werden. Eine regelmäßige und rechtzeitige Entwurmung ist notwendig, um die Würmer noch im Larvenstadium nebenwirkungsfrei zu bekämpfen. Ergänzend ist ein Schutz der Hunde vor dem Angriff der übertragenden Stechmücken als vorbeugende Maßnahme sinnvoll.
Gefahr für den Menschen
Generell können Menschen mit D. repens infiziert werden, auch wenn bei einem normalen Krankheitsverlauf die Würmer nur subkutan existieren. Da die Würmer aber in Hunden oft in großer Zahl vorliegen, reduziert eine Bekämpfung von D. repens im Hund gleichzeitig auch das Infektionsrisiko für den Menschen.
Entwurmung, wann und wie
Wann werden Welpen entwurmt?
Durch die Tatsache, daß alle Welpen schon über die Mutterhündin mit Würmern infiziert werden und die Folgen beim Welpen besonders schwerwiegend sind, ist es von großer Bedeutung Welpen schon im Alter von zwei Wochen erstmals zu entwurmen.
Die Entwurmung ist vom Züchter anschließend alle zwei Wochen zu wiederholen bis die Welpen im Alter von 8-10 Wochen abgegeben werden. In ihrer neuen Heimat sollten sie dann nach ein bis zwei Wochen nochmals gegen Spul- und Hakenwürmer entwurmt werden.
Wie entwurme ich meinen jugendlichen und erwachsenen Hund?
Ein weit verbreiteter Irrtum ist, daß die Entwurmung vorbeugend hilft und über einen gewissen Zeitraum anhält. Das ist, anders als beispielsweise bei manchen Mitteln in der Flohbekämpfung, leider nicht der Fall!
Eine Entwurmung tötet, abhängig von ihrem Wirkungsspektrum, lediglich die jeweils vorhandenen Würmer und Larvenstadien ab. Gegen die verschiedenen Wurmarten wirksame Wurmmittel sind in verschiedenen Formen auf dem Markt. Sie sind allesamt rezeptpflichtig und daher nur beim Tierarzt erhältlich. Am Gebräuchlichsten sind Tabletten (auch in Form von Leckerli), Pasten, oder Flüssigkeiten.
Auch eine Entwurmung durch Injektion ist möglich. Ganz neu ist ein Mittel, das gleichzeitig auch gegen äußere Parasiten (Flöhe, Milben usw) hilft und aufs Fell aufgetragen wird. Je nach Wurmmittel muß die Entwurmung einmalig oder mehrmals hintereinander durchgeführt werden.
Lassen sie sich unbedingt von ihrem Tierarzt beraten. Er kann entscheiden, welches Mittel für Ihren Hund am geeignetsten ist.
Glauben sie bitte nicht an die Ammenmärchen, man könnte mit Knoblauch oder Karotten Hunde entwurmen.
Auch ist (bei allem Respekt vor der Homöopathie ) eine homöopathische oder pflanzliche Entwurmung nicht wirksam. Die traurigen Ergebnisse solcher Versuche, die bei Welpen nicht selten mit dem Tod enden, sehen wir leider immer wieder in der Praxis.
Da die Entwurmung nicht vorbeugend wirkt, ist es wichtig sie regelmäßig etwa 3-4 x jährlich zu wiederholen.
Wie oft muß die Zuchthündin entwurmt werden?
Um die Ansteckungsrate der Welpen über die Mutterhündin etwas einzudämmen (leider läßt sie sich auch dadurch nicht ganz verhindern) wird eine zur sonst üblichen Entwurmung zusätzliche Entwurmung vor dem Decken und ca. 10 Tage vor der Geburt empfohlen. Auch mit der ersten Entwurmung der Welpen ist die nochmalige Behandlung der Hündin anzuraten.
...Und noch was:
Die Wurmmittel, die uns heutzutage zur Verfügung stehen sind für die Hunde sehr gut verträglich und es werden im Gegensatz zu früher so gut wie keine Nebenwirkungen beobachtet. Sie können und sollten also ohne Bedenken regelmäßig angewandt werden.
Eigene Website, kostenlos erstellt mit Web-Gear
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage. Missbrauch melden |